kljö asdöfjaösdjfö siduökdsjfaösd jföslkd jföx ökjc ljöljöwjölakrserj kj98üw34ASDF SDFASDFh sdfja18248 kn sdfjöasljdf oiquiöa kjöadshfjo8qp4ou ljö sdfhj Aljs df …
… oh, Sorry! Das war meine Katze, die über die Tastatur gelaufen ist. Seit sie mir bei Tokyo Jungle zugesehen hat, ist sie etwas aufmüpfig geworden.
Charles Darwin hätte mit dem Spiel ohne Zweifel seine helle Freude gehabt. Seine Theorie der natürlichen Auslese wird vor dem Hintergrund der in naher Zukunft von Menschen verlassenen japanischen Metropole nicht nur zum zentralen Element, sondern bei genauerer Betrachtung sogar liebevoll parodiert. Übrig geblieben sind nur die Tiere. Aus Zoos, Tierheimen und Haushalten. Angetrieben durch die eigene Arterhaltung kämpfen sie fortan zwischen den urbanen Ruinen um ihre Reviere. Das klingt zunächst einmal gar nicht so unplausibel. Doch spätestens wenn eine Horde an kleinen Küken in Begleitung treibender Techno-Beats über einen ausgewachsenen Löwen herfällt und diesen innerhalb von Sekunden reißt, können sich selbst bierernste Naturforscher mit den zusammengekniffensten Arschbacken sicher kein Schmunzeln verkneifen. Vor allem, wenn der König bei seinem Fall vom Thron ein Mieder trug. Und die Küken allesamt Baseball-Caps.
Richtig gelesen.
Tokyo Jungle macht sich den Vorteil seines eigenen Mediums zunutze und projiziert die absurdesten Kampfsituationen auf den Schirm. Seine eigene Hauskatze sieht man danach in einem ganz anderem Licht. Glaubt mir, ich erfahre es gerade an meinem eigenen Leisadfjöasdf poWRSDF … hey, lass das! Runter vom Tisch!
Dabei täuscht uns das Spiel auf den ersten Blick gehörig und vermittelt fast frech eher den Eindruck als wolle es eine düstere Postapokalypse erzählen. Die Farbpalette besteht vorwiegend aus Grautönen und, nun ja, noch mehr Grautönen. Die beinahe über die Tiere herabfallenden, weil instabil wirkenden Häuserschluchten von dem Bezirk Shibuya lassen jene umso verletzlicher wirken. Die triste, eher fotorealistisch gehaltene, aber gerade deshalb konsequente Darstellung von Zerfall im nun wortwörtlichen Großstadtdschungel hätte trotz der veralteten Technik einer seriösen Geschichte durchaus gut zu Gesicht gestanden.
Auch die Spielelemente sind zunächst von ernster Natur: Die erdenklichsten Säugetiere können aus allen Winkeln der zerfallenen Straßen auf das eigene lauern und gerade Nachts führen Überraschungsangriffe schnell zum Tod. Verkriechen und Verstecken ist nicht möglich, denn laufend nagt der Hunger und die Nahrungssuche führt in immer abgelegenere feindliche Gebiete. Und da ist natürlich noch die Fortpflanzung. Ein williges Paarungstier muss gefunden und von der eigenen Überlebensfähigkeit – im Spiel dargestellt durch Ränge – überzeugt werden. Das sollte auch innerhalb des Lebenszyklus stattfinden, denn nach 15 Jahren stirbt ein Tier an Altersschwäche. Im Generationswechsel werden die Fortschritte an die Kinder weitergegeben und man ist dann zunächst im Rudel unterwegs. Stirbt das gerade zu spielende Tier, geht die Kontrolle an ein anderes Mitglied über. Ist das Rudel dezimiert, ist auch das Spiel vorbei, es sei denn, man sorgt sich rechtzeitig um neuen Nachwuchs.
Tokyo Jungle verzichtet allerdings komplett darauf … öhm, also Tokio Jungle verzichtet … Pardon, aber dieser Blick meiner Katze ist gerade massiv irritierend! Ihr kennt sicher diese Momente, in denen Katzen einen unausweichlich anstarren. Das macht meine nun auch, aber in dieser Intensität habe ich das bisher noch nicht gesehen … Brrr … also jetzt hör‘ mal auf damit! Runter da! Und bleib‘ mal auf dem Boden!
Also, das Spiel verzichtet darauf die Erklimmung der Nahrungskette mit aller Verbissenheit zu erzählen, sondern hat vorwiegend Erheiterung im Sinn. Die hohe Spielgeschwindigkeit und die nach einer kurzen Anspielzeit schnell sichtbare Transparenz der Spielmechaniken beherbergen zwar die Gefahr, dass das Spiel nach einer Zeit redundant wirken könnte, doch es entwickelt sich so ein gewisser Arcade-Flair. Schlagen, Ausweichen, Schleichen. Die Steuerung ist dabei simpel und nutzt nicht einmal alle Buttons des Pads. Die schnellen Kämpfe verlangen aber trotzdem gutes Timing, vor allem der sofort tödliche Kehlenbiss kann nur in Sekundenbruchteilen ausgeführt werden.
Genossen werden möchte es aber vorwiegend in kleinen Dosen. Der Story-Modus ist viel zu unaufregend wie belanglos erzählt und schüttelt nie den Flair eines Tutorials ab, muss aber zum Freischalten einiger Tiere trotzdem gespielt werden. Der an das Roguelike-Genre angelehnte Survival-Modus gleicht das aber locker aus: Von kleinen Miniaufträgen abgesehen, in denen man bestimmte Tiere töten oder Gebiete einnehmen muss, wird dort nur ein übergeordnetes Ziel gestellt: Überlebe! Man kann bis zum Tod spielen und versuchen sich in der Weltrangliste zu platzieren. Und glaubt mir: Mehrere Jahrzehnte und Generationen in der immer aggressiver werdenden feindlichen Umgebung bis zum letzten Atemzug zu überdauern hat etwas ungemein befriedigendes! Vor allem, wenn man es zu zweit spielt. Im lokalen Multiplayermodus teilt man sich einen Bildschirm und kämpft im Team. Zufällige Natureinflüsse, wie etwa Tag- und Nachtwechsel, Gift oder Hitze, kommen als erschwerende Faktoren hinzu. Mit etwa fünfzig freispielbaren Tieren besteht zudem noch ein klassischer Anreiz hin und wieder eine neue Runde einzulegen, um ein noch größeres Tier zu erspielen. An meiner Katze sehe ich aber gerade, dass man gar nicht groß sein muss, um bedrohlich zu wirken. Brr. Augenblick, ich stelle ihr mal lieber etwas zu Essen hin. Bin gleich wieder da.

Die Mannigfaltigkeit der Tierarten bereitet im Spiel viel Freude; gerade weil auch Haustieren die Möglichkeit gegeben wird die Nahrungskette hinaufzuklettern. Dieser Humor ist schon fast subtil, da nicht das Art Design diese Absurdität vermittelt, sondern eher die Spielmechaniken und Situationen.
So. Leider ist trotz der Unterscheidung zwischen Fleisch- und Pflanzenfressern die spielerische Mannigfaltigkeit zwischen den Arten eher gering. Zwischen beiden Rollen gibt es wesentliche Unterschiedliche in dem Gewicht der Stealth-Komponenten des Spiels; als Reh hat man beispielsweise wenig davon sich mit einem Raubtier anzulegen, weil man das als Fluchttier nunmal nicht fressen kann. Doch abgesehen von der körperlichen Stärke tut sich zwischen den Gattungen nicht viel.
Versöhnlich stimmt aber, dass man die Tiere im weiteren Verlauf mit allen erdenklichen Kleidungsgegenständen ausstatten kann. Eine Kuh im Schuluniform? Machbar. Ein Ochse im Hip Hop-Outfit? Kein Problem. Der Clou dabei ist, dass die Bekleidung auch die Stats und somit Kraft und Ausdauer aufwertet. Einen Hirsch mit Turnschuhen auszustatten und mit ihm von Busch zu Busch zu schleichen ist somit also nicht nur ein urkomisches Gimmick.
Man kann Tokyo Jungle seinen spröden Charme nicht absprechen. Die Grundidee ist ungewöhnlich, die Ausführung trotz kleiner Fehler erhaben und die vielen bizarren Verzierungen durch die Kostüme verrückt wie mutig. Ja, Darwin hätte mit diesem Spiel nicht nur seine helle Freude gehabt, sondern sich Lachtränen aus dem Gesicht gewischt und die Entwickler für die humorvolle Annäherung an seine Theorien beglückwünscht. Da bleibt nur die Frage ob siö sdjf öaskdj ök aösdkfa kjösdjfl …
… HEY! Jetzt reicht‘s aber mal! Ich habe dir doch gerade … hmm? Wieso hast Du denn deinen Napf nicht leer gemacht? Hallo? Dein Blick gefällt mir aber gerade gar … aah … ARGH sa.djf äaslidföualsidufösaidufkjöaw3lir …
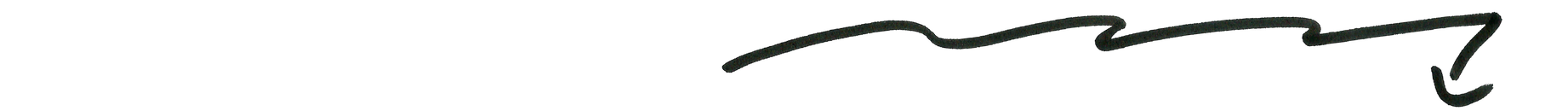









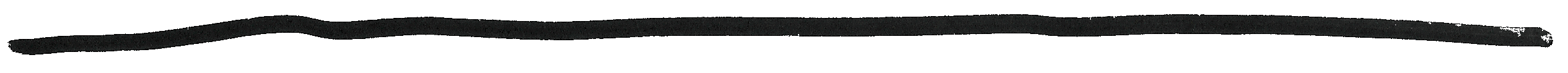


Szenarien, in denen sich die Natur das zurückerobert, was die verschwundene Menschheit zurücklässt, sind ja interessant, aber ich habe Tokyo Jungle angespielt und finde: Meh. Es ist ein simples Jump&Run mit Auflevel-Mechaniken, die als „Evolution“ durchgehen sollen. Hmja.
Schöner Text. Gefällt mir.
Ahaha, grandioser Artikel!
Ich finde die Nachricht von der Katze sehr interessant. Vielleicht muss man die Sprache der Katze identifizieren? :) Als ich den Text gelesen habe, hatte ich diese Katze im Hinterkopf http://www.fressnapf.de/community/galerie/bilddetail/waagehexe/mmhhhhhhhhhhh Eigentlich wäre ein Film mit der gleichen Idee auch sehr interessant.