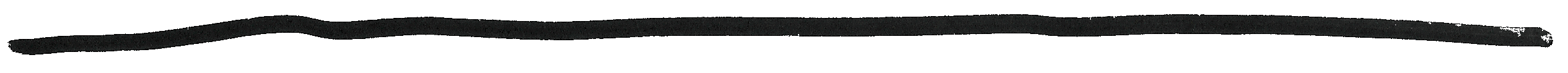Es gibt eine Reihe von Eigenschaften, die Andreas Gurskys Arbeiten besonders kennzeichnen. Neben den seit 1992 bewusst und betont eingesetzten digitalen Eingriffen, ist es vor allem seine besondere Fähigkeit eine Perspektive zu wählen, die eine gewisse Distanz dem Abgebildeten und dem Betrachter erzeugt. Sie ist nicht groß genug, um das Bild ganz abstrakt erscheinen zu lassen, aber gerade nah genug, um einen gewissen Grad der Immersion zu bewirken. Gurskys Bilder sind – salopp formuliert – gerade so weit vom Geschehen entfernt, als dass man sich gerade vorstellen kann, was dort geschieht. Ein gutes Beispiel dafür ist sein Bild „Bundestag, Bonn“ (1998): Das Foto wurde außerhalb des Saals aufgenommen, durch das Fenster kann man einige prominente Gesichter erkennen und ebenso erahnen, dass dort offenbar eine Abstimmung stattfindet. Trotzdem ist die Perspektive so weit weg, dass wir nicht Teil des Bildes werden, sondern die Position eines Beobachters einnehmen.
An diesem Bild zeigt sich auch der für Gursky typisch gewordene digitale Eingriff in seine Fotografien: Betrachtet man die Spiegelungen an den Scheiben genauer, so stellt man fest, dass diese physikalisch nicht korrekt und digital ergänzt worden sind. Durch diesen Eingriff verstärkt Gursky die Wirkung seines Bildes: Das Parlament suggeriert durch die Anordnung der Stühle, der kreisrunden Form des Saals und der Kleidung der Politiker Ordnung, doch in Wirklichkeit ist die Atmosphäre zerrissen durch Meinungsverschiedenheiten. Die Holzrahmen am Fenster zerteilen das aus Medien bekannte geordnete Bild des Bundestages; die Spiegelungen verstärken es zu einem fast spürbaren Durcheinander.
Die anfängliche Irritation bei der Betrachtung seiner Bilder ist ein Mittel, wie Gursky die Aufmerksamkeit seines Publikums erhascht und sie so zur Aussage seiner Arbeit heranführt. Bezeichnend für seine Arbeiten ist ebenso, dass der Mensch nie das Zentrum seiner Bilder ist, sondern er sie – sofern sie überhaupt auftauchen – zum gleichgewichtigen Teil seiner Gesamtkomposition macht. Gursky ist nicht an dem Schicksal des Einzelnen interessiert, sondern vielmehr an den Mosaiksteinen, die zusammen das Weltgeschehen formen. Die Dimension dieser Steine bewegt sich in den Größenordnungen einer Fabrik, einer Menschenmenge oder eines Gebäudes. Ihn interessiert, wie sie sich in die Welt einfügen, in welche Richtungen sie schauen, wie sie das Weltpanorama ergänzen oder aus der Reihe fallen. Er selbst spricht davon, dass sein Ziel die „Enzyklopädie des Lebens“[1] ist. Betrachtet man sein bisheriges Werk, so ergibt sein Schaffen bereits ein künstlerisches Gesamtbild von den Strukturen der Welt der letzten 30 Jahre.
Betrachtet man jedoch seine aktuellste sechsteilige Serie „Ocean I-VI“ (2009 – 2010), so dürfte selbst der geneigte Gursky-Kenner zunächst etwas irritiert sein: Die Bilder muten zunächst wie ein Auszug aus einem Atlas an, zeigen sie doch ein Satellitenbild der Erdkugel, nur dass die Weltmeere ins Zentrum gerückt sind. Gezeigt wird also kein bestimmter Ort der Welt, der greifbar erscheint, und auch keine fluide Bewegung von Menschenmassen, die zumindest geringfügiges Identifikationspotential beherbergt, sondern ein äußerst abstraktes, zunächst sachlich wirkendes Bild unseres Planeten. Schon die Entstehung der Serie ist für Gursky untypisch: Statt ein selbst geschossenes Foto digital zu verfremden, griff er auf hochaufgelöstes Satellitenmaterial zurück und ergänzte es mit diversen Bildquellen aus dem Internet. Da das Material aber nur die Landmassen abdeckt, musste der überwiegende Teil der Meere und der Übergang zwischen Wasser und Land digital nachkonstruiert werden. Die Meeresoberflächen wurden mit Orientierung an authentischen Tiefenkarten ausdifferenziert. An dieser Serie ist also fast alles digital, alles konstruiert und zusammengeflickt. Auf den ersten Blick ergibt sich bezüglich des Abstraktionsgrades eine Parallele zu „Supernova“ aus 1999, vom Aufwand her gemessen an der Serie „F1 Boxenstopp“ aus 2007.
Betrachtet man die Bilder genauer, erkennt man, dass Gurskys Interesse nicht etwa kartografischer Natur ist, sondern dass er erheblich in die geografischen Verhältnisse eingegriffen hat. Die Abstände zwischen den Kontinenten stimmen nicht mit der Wirklichkeit überein; Bereiche der Weltmeere, sowie auch Elemente vom Land wurden nach kompositorischen Gesichtspunkten manipuliert und im Hinblick auf eine Gesamtwirkung angepasst. Was auf dem ersten Blick bereits zu erahnen ist, wird bei der genaueren Analyse umso deutlicher: Die in der Kartografie nur begrenzt verwertbare Komponente der Weltmeere wird hier in das Zentrum gerückt; die Landmassen sind nur eine Randerscheinung, die im Gegensatz zu einer realen Weltkarte aus einem Atlas nur einen kleinen Teil des Blickfeldes einnimmt. So wird die Sehgewohnheit von geografischen Bildern ad absurdum geführt: Die eigentlichen Orientierungspunkte von Karten werden bewusst an den Rand gerückt, die prinzipiellen Lebensräume von Menschen quasi zur Seite gekehrt. Stattdessen wird dem dunkelblauen Weltmeer die Bühne überlassen. Eine gerade durch die mehrere Meter große Leinwand geradezu bedrohlich wirkende Wassermasse, die die wenigen Flecken Land zu verschlingen droht. Die hellen, farblich mannigfaltigen Reste der Kontinente wirken im Gegensatz zu den dominant dunklem Meer wie ein schwacher Trost, an dem man sich als Betrachter klammern kann, ohne sich zusehends in der blauen Tiefe zu verlieren.
Durch die Zentrierung der Meere entrückt Gursky das bereits im Kindesalter durch Erdkunde eingeprägte Gefühl der Ordnung, die man sonst von geografischen Karten kennt, und spricht ein aktuelles Gefühl und Problem an, das von Umweltschützern schon seit Jahren angesprochen wird: Aussichtslosigkeit in Anbetracht der aktuellen Erkenntnisse der Umweltzerstörung, vor allem in Hinblick auf die globale Erwärmung. Kartografische Karten lassen auch wegen des ökonomischen Nutzens in den Hintergrund rücken, dass der Großteil der Erde aus Wasser besteht. Bewusst wird dies bei der Studie einer Weltkarte allerdings nicht, gerade weil dort üblicherweise das Gefüge der Kontinente die Hauptaufmerksamkeit erlangt. Durch die Akzentuierung der Weltmeere macht Gursky aber ebenso deutlich: Vor dem Wasser gibt es kein Entrinnen. Sind auch die letzten Flecke Land überschwemmt und verschwunden, bleibt Mensch und Tier kein weiterer Lebensraum mehr.
So kommt es nicht von ungefähr, dass in der Serie auch ein Bild auftaucht, dass formal aus dem Rahmen fällt: „Antarctic“ zeigt eine zugunsten der Bildwirkung veränderte Version der Arktis. Doch statt dass hier das blaue Meer das Bildzentrum bildet, ist es die weiße Eisfläche des Kontinents. Im Kontext mit den anderen Bildern „Ocean I-VI“ macht Gursky hier vor allem deutlich, dass die Eisfläche nur ein anderer Aggregatzustand des Meeres ist. So ist „Antarctic“ nur formal ein Ausreißer, inhaltlich allerdings mehr als entsprechend. Was also zunächst aussieht wie ein typisches Kartenbild von einem Kontinent, ist im übertragenen Sinne ironischerweise keines. Den Halt, den das Auge des Betrachters an der Eisfläche sucht und in den Randbereichen der anderen Bilder gefunden hat, ist im Grunde nur eine vermeintliche Sicherheit, die wie in der Realität dahinschmilzt. Die Arktis ist das Meer, das Meer ist die Arktis. In diesem Zusammenhang wirkt „Antarctic“ wie ein Vorzeichen drohenden Unheils.
Wie bei älteren Werken begibt sich Andreas Gursky mit dieser Arbeit erneut in ein fotografisches Grenzgebiet, so wie es etwa 1996 bei der „Prada“-Serie geschehen ist, die an der Werbefotografie angelehnt war. In allen Belangen erreicht Gursky diesmal allerdings einen völlig neuen Entwicklungsschritt in seinem künstlerischen Schaffen. Neben der technischen Weiterentwicklung ist es auch die Ernsthaftigkeit der Metaebene, die gegenüber seiner bisherigen Arbeit einen neuen Level erreicht hat. Zunächst ist der Schritt in die globale Dimension beachtlich. Hat Gursky wie eingangs erwähnt „lediglich“ Mosaiksteine dieser Welt betrachtet, schaut er diesmal sprichwörtlich auf den gesamten Globus. Mit dieser Perspektive hat sich auch die Tragweite der Botschaft hinter dieser Arbeit verändert: Gursky geht weg von den Momentaufnahmen, die er in den Fotos der 80er geschossen hat. Er geht weg von dem subtilen und gleichzeitig gesellschaftskritischen Humor, wie er sie in den digital veränderten Bildern „Paris, Montarnasse“ (1993) oder „Hauptversammlung, Diptychon“ (2001) auszudrücken wusste. Er ignoriert seine Liebe zur Aufdeckung von horizontalen und vertikalen Linien in Landschaften wie es in „Engadin II“ (2006) oder „Greeley“ (2002) der Fall ist. Nein, sein Anliegen ist ernster denn je und er mischt mit seiner Serie an der Spitze des zeitgenössischen Diskurses mit. „Ocean I – IV“ und „Antarctica“ betreffen nicht bestimmte Regionen oder Menschengruppen, sondern nichts anderes als die Menschheit selbst. Insofern wirkt die Serie in Bezug auf seine „Enzyklopädie des Lebens“ wie der vorläufige Zenit seines Schaffens – auch wenn er sich mit älteren Arbeiten schon einmal in den Weltraum begeben hat, ist gerade diese Arbeit samt und sonders durch einen Blick in eine mögliche düstere Zukunft motiviert.
Was hat das bisherige Lebenswerk von Andreas Gursky mit Videospielen zu tun? Im Wesentlichen ist ein Rückblick auf die Arbeiten des Künstlers im übertragenen Sinne die Allegorie zu dem nicht genutzten Potential des digitalen Zeitvertreibs. Leider sind Spiele derzeit kaum mehr, als eben dies: Eine auf ästhetischer Ebene oft durchaus ansprechende, aber im Subtext kaum tiefer greifende Erfahrung, die sich viel zu sehr dem Dogma der puren Unterhaltung verschrieben hat. Nur eine Minderheit aus dem bunten Sammelsorium bisheriger Spiele schafft es, was Gursky durch fast jede seiner Fotografien gelingt: Dem Rezipienten eine neue Perspektive zu offenbaren. Dem Spieler bei der Nachahmung der Realität eine neue Sichtweise zu geben; ihm zu zeigen, wie es auf der anderen Seite, in einer anderen Zeit, in einer anderen Haut aussieht. Es gibt einige Dinge die Videospiele besonders gut können, wenn sie wollen, und uns in die Rollen anderer oder einen abstrakten Betrachtungspunkt zu versetzen und somit neue Blickwinkel zu eröffnen ist eine noch schlummernde Stärke, auf die sich Entwickler und Designer in Zukunft ruhig stärker konzentrieren dürfen.
- [1]„Ich verfolge nur ein Ziel: die Enzyklopädie des Lebens“, Andreas Gursky, zit. nach Helga Meister, „Fotografisches Lexikon des Lebens“, in: Westdeutsche Zeitung, 3. Mai 2001, S. 20K↩